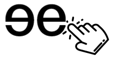Philosophie / Leitbild
Unternehmen müssen in der Lage sein, die wesentlichen Bestandteile der Unternehmenskultur mit einer Beschreibung des zukünftigen Weges und der Ziele des Unternehmens zu verbinden. Diese Kernelemente sind der Schlüssel für die Strategieentwicklung und wichtig als zentrales, übergreifendes Leitbild für die Führung eines Unternehmens sowie für dessen langfristige Ausrichtung. Das klingt sehr hochtrabend und theoretisch, kann in der Praxis je nach Größe oder Komplexität des Unternehmens dennoch smart definiert werden. Denn im Kern geht es darum, aufzuschreiben, warum ein Unternehmen existiert, welchen Nutzen es stiftet, wo es sich hin entwickeln soll und welchen Charakter es als Organisation dabei entwickeln soll. Dazu dient die Unternehmensphilosophie (Corporate Philosophy), welche die Vision, Mission und Ziele eines Unternehmens benennt. Achtung, nach dem Aufschreiben kommt die Umsetzung, und zwar mit der nötigen Konsequenz und Verbindlichkeit!
Im Rahmen der Unternehmensphilosophie werden diese Dinge zunächst möglichst einprägsam und einfach formuliert, sodass eine bessere Übersetzung und Verankerung im Bewusstsein der Menschen im und um das Unternehmen gelingt. Außerdem ist es wichtig, den Wirkungszeitraum bzw. den Betrachtungshorizont weiter in die Ferne zu legen, damit genügend Zeit für realistische Umsetzungspläne, Adaptionen und Detaillierungen bleibt und nicht permanent nur neue Leitbilder definiert werden.
Die wesentlichsten Elemente der Unternehmensphilosophie sind:
Das Unternehmen und seine VISION
Kein erfolgreiches Unternehmen existiert nur aufgrund der Freude am Dasein. Erfolgreiche Unternehmen erfüllen keinen Selbstzweck, sondern schaffen einen Mehrwert für den Markt. Bei der Formulierung der Vision geht es genau um die zentrale Frage «Welchen Mehrwert bietet das Unternehmen den Kunden?» Viele Unternehmer:Innen antworten darauf, dass sie genau sagen können, welchen Mehrwert sie stiften. Bei der Frage, ob dies die übrigen Mitarbeiter im Unternehmen auch genau so sagen können und ob das die Kunden genauso bestätigen werden einige von Ihnen vermutlich nur ausweichend der eher allgemein antworten. Und wenn es dann zu der Frage kommt, ob die internen Maßnahmen-, Ressourcen- und Umsetzungspläne nachvollziehbar, verbindlich und messbar mit der Schaffung und dem Erhalt dieses Mehrwertes verbunden sind werden mindestens ebenso viele Unternehmer:Innen bei ihren Antworten ins Stocken geraten.
Die Unternehmensvision ist die positiv formulierte Vorstellung davon, welchen Zustand (Mehrwert) das Unternehmen in der Zukunft schaffen will. Mit der Vision wird also die Richtung vorgeben, in die sich das Unternehmen entwickeln soll, sie muss inspirierend und motivierend sein. Wichtig ist hier möglichst klare, prägnante und allgemeinverständliche Formulierungen zu wählen. Auf ausschweifende und kundenunspezifische Inhalte ist zu verzichten. Die sehr gut formulierten Visionen von erfolgreichen Unternehmen sind sehr kurz, einfach und smart.
Die Vision ist damit der Ausgangspunkt für alle weiteren strategischen Elemente des Unternehmens. Manche Unternehmen unterschätzen die Bedeutung und die Wirkung einer guten Vision, von der aus sich alle weiteren Aktivitäten und Handlungen des Unternehmens ableiten. Gern wird an dieser Stelle mit Aufmerksamkeit gespart, Zeit abgekürzt und weniger konsequent auf eine real gelebte Verankerung geachtet. Die Praxis zeigt, dass es sich in diesen Fällen oft rächt, indem die Motivation und Performance der Mitarbeiter hinter den Erwartungen zurückbleiben und wertvolle Ressourcen auf die falschen Aktivitäten gerichtet werden.
Gute Beispiele für Unternehmensvisionen
Weniger gute Beispiele für Unternehmensvisionen
Das Unternehmen auf seiner MISSION
Mission oder Vision das klingt ähnlich und ist jetzt aber wirklich zu viel der theoretischen Übung – oder doch nicht? Vielleicht hilft es zum besseren Verständnis, wenn man sich eine Aufbauanleitung für ein Möbelstück vorstellt, in der einige der einleitenden Arbeitsschritte und Erläuterungen weggelassen werden, weil sie dem Hersteller selbsterklärend oder überflüssig vorkommen. Wer kennt nicht das Erlebnis, wenn anhand solcher Anleitungen mehrere Auf- und Rückbauversuche nötig sind und im ungünstigsten Fall am Ende trotzdem einige Bauteile übrig sind. So ähnlich könnte es sich auswirken, wenn ein Unternehmen ohne Vision und/oder Mission direkt mit der Implementierung der strategischen Ziel- und Maßnahmenplanung beginnt. Wer nicht riskieren möchte, dass verärgerte Käufer negative Shoppingbewertungen abgeben, der wird sich dafür Zeit nehmen müssen. So verhält es sich auch mit Vision und Mission. Während die Unternehmensvision die Vorstellung davon ist, was ein Unternehmen in Zukunft (=Zustandsbeschreibung) erreichen möchte, ist die Mission eine Formulierung des Hauptzwecks und des Schwerpunkts einer Organisation. Üblicherweise bleibt die Mission im Laufe der Zeit unverändert und verkörpert den Auftrag oder Geschäftszweck des Unternehmens sowie ein Bekenntnis zu bestimmten Werten.
Gute Beispiele für Mission Statements von oben genannten Unternehmen
Die Strategie
In der Unternehmensführung sind Begriffe wie strategisches Management oder Unternehmensstrategie fest verankert. Dennoch drängen sich in der Unternehmerpraxis häufig die operativen Fragen in den Vordergrund und dominieren das Denken und Handeln. Damit sind beispielsweise Fragestellungen gemeint, ob sich die Produkte lohnen, wie an den laufenden Projekten gearbeitet wird, welche Kunden am meisten Druck erzeugen oder wo die Ressourcen gerade knapp sind. Die für eine nachhaltige Strategie bedeutsame Frage ist aber, wo möglichst nachhaltige Wettbewerbsvorteile in der Zukunft liegen und ob das Unternehmen überhaupt die richtigen Produkte anbietet oder welche Kernmaßnahmen und Ressourcenblöcke den Umsetzungsplan der kommenden Jahre bestimmen. Die Art und Weise des Umgangs mit diesen Fragestellungen bilden den Grundstein für ein erfolgreiches strategisches Management und die Implementierung einer, unter realen Gegebenheiten, funktionierenden Strategie.
Erfahrungsgemäß gelingt das strategische Management in denjenigen Unternehmen besser, in denen bewusst zwischen strategischer und operativer Planung unterschieden wird. Dies gilt auf der inhaltlichen, prozessualen und gegebenenfalls auch funktionalen Ebene. Zwischen strategischer und operativer Planung besteht ein Unterschied bezüglich des Planungsinhalts und der Herangehensweise. Der renommierte Ökonom Peter F. Drucker beschrieb den Unterschied so, dass strategische Planung mit den Worten zu umschreiben ist „Doing the right things“, während die operative Planung mehr das „Doing the things right“ beinhaltet. Da man zuerst definieren muss, was die richtigen Dinge sind und erst danach genau diese Dinge richtig machen kann, ist die strategische Planung (Strategie) der operativen Planung (Umsetzung) vorgelagert.
Es liegt also nahe, dass im Prozess der Unternehmenssteuerung die strategische vor der operativen Planung erfolgt. Wichtig ist dabei ein Grundverständnis dafür zu haben, dass die Details der operativen Planung jährlich oder unterjährig angepasst werden, während der Turnus zur Erneuerung der strategischen Planung in der Regel deutlich länger ist. Dies ist ein Punkt, der in der Praxis häufig falsch gemacht wird. Immerhin sollen Strategien operativ umgesetzt und nicht ständig neu entwickelt werden.
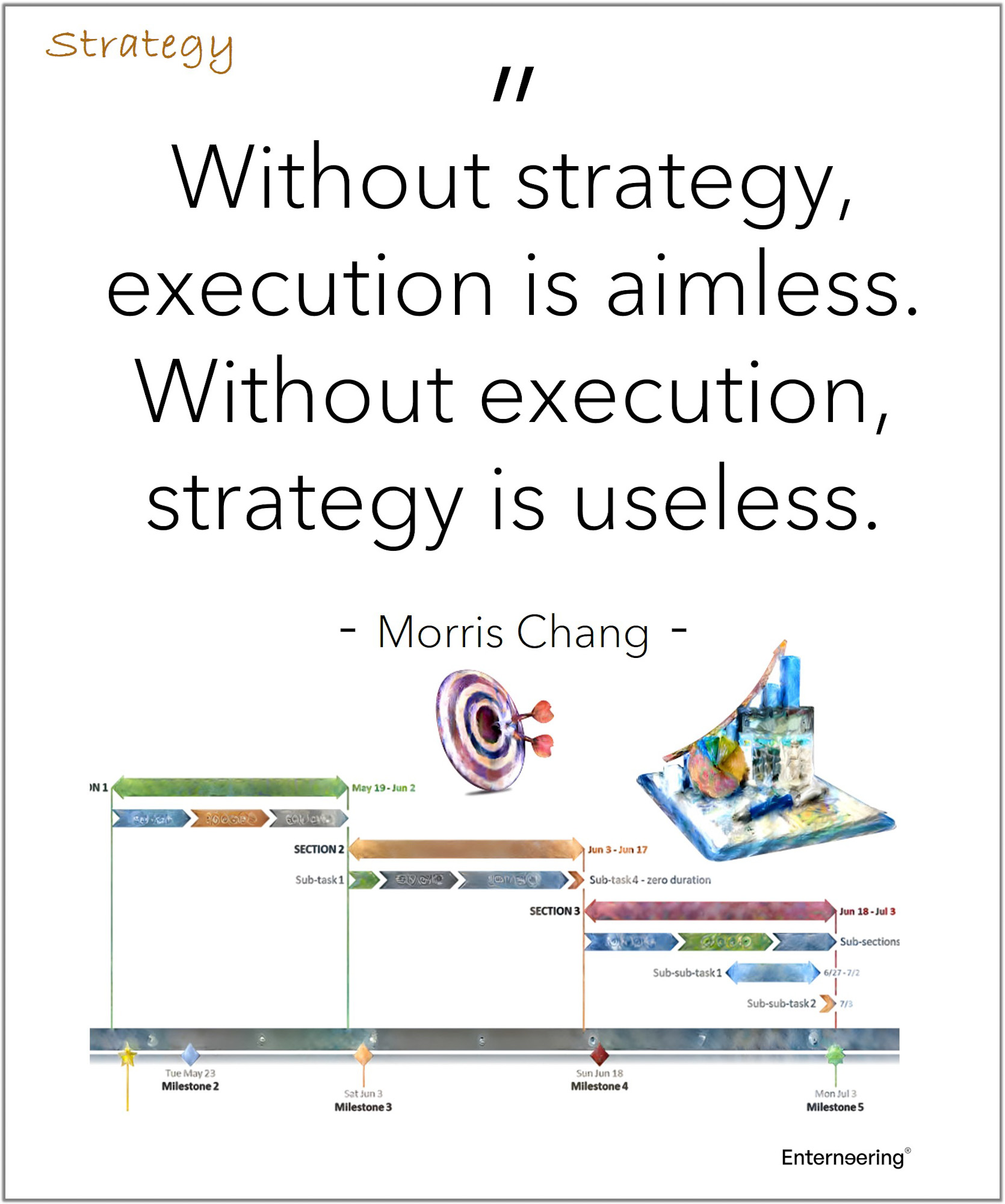
Das Ziel einer ganzheitlichen Unternehmensstrategie ist es, eine ehrgeizige, aber dennoch erreichbare Vision durch aussagefähige Ziele zu konkretisieren und diese Ziele wiederum durch geeignete Umsetzungsschritte zu untersetzen. Die Unternehmensstrategie enthält also den Plan, der die spezifischen Ziele, Schritte und Maßnahmen definiert, welche erforderlich sind, um die Vision zu erreichen. Auf der Grundlage eines klaren Verständnisses der Wettbewerbsfähigkeit legt die Unternehmensstrategie einen mehrjährigen Fahrplan fest, wie die Vorteile am besten genutzt werden können, um eine rentable Entwicklung und eine starke, nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen. Eine erfolgreiche Unternehmensstrategie bestimmt das optimale Geschäftsportfolio, setzt Prioritäten für die richtigen Werttreiber und legt eine Ressourcenverwendung fest, um die Vision und Ziele in konkrete Maßnahmen zu überführen, welche schließlich zu messbaren Ergebnissen und echten Werten führen.
Mit anderen Worten: Die Unternehmensstrategie ist ein einzigartiger Plan oder Rahmen, der langfristig angelegt ist und darauf abzielt, neben der Vision einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erzielen und gleichzeitig die Versprechen gegenüber Kunden und Stakeholdern zu erfüllen.
Eine andere, sehr viel einfachere Sichtweise der Unternehmensstrategie besteht darin, sie als eine Reihe von Entscheidungen und Maßnahmen zu betrachten, auf die ein Unternehmen seinen Fokus und seine Aktionen für die Zukunft legt, um die eigene Vision und die Ziele zu erreichen. Da jedes Unternehmen nur über eine begrenzte Menge an Ressourcen verfügt, muss es entscheiden, wie es diese Ressourcen vorrangig einsetzt.
Ohne eine klare Unternehmensstrategie verlieren Unternehmen ihre Hauptziele aus den Augen und es fehlt ihnen der Antrieb und der Fokus, welchen eine gut durchdachte Unternehmensstrategie bietet. Eine ganzheitliche Strategie befähigt das Unternehmen, ein praxistaugliches Performance- und Ressourcenmanagement zu etablieren. Schließlich handelt es sich um eine Art Handbuch und eine Übersetzung des Unternehmensplans für alle Personen innerhalb des Unternehmens, aber auch für externe Stakeholder.
Im Bereich des People Management nimmt die Unternehmensstrategie eine wichtige Schlüsselrolle für die Einbindung, Motivation und Ausrichtung der Mitarbeiter ein. Mit ihrer Hilfe können die Ideen, Vorstellungen und Absichten des Unternehmens besser vermittelt werden. Menschen können somit klar und messbar ihren eigenen Beitrag zur Erreichung der Strategie erkennen, bewerten und optimieren. Insbesondere in modernen, agilen und selbstorganisierten Unternehmensstrukturen ist eine funktionierende Unternehmensstrategie eine essenzielle Grundlage für den Erfolg der gesamten Organisation.
Der Weg zur STRATEGIE
1. VISION, MISSION
Mindestens das Vision Statement, idealerweise auch das Mission Statement, sollten bei länger bestehenden Unternehmen im Kontext der Unternehmensphilosophie bereits definiert worden sein, anderenfalls wären dies die ersten Aufgaben auf dem Weg zur Strategie.
2. STRATEGISCHE ZIELE
Ein oder zwei Sätze als Vision stellen aus Sicht der Unternehmensplanung keine ausreichend formulierten Ziele dar. Die Hauptmerkmale guter strategischer Ziele sind, dass sie einen eindeutigen Bezug zur Erreichung der Vision haben, dass sie detailliert genug sind, um Umsetzungsmaßnahmen und -bedarfe abzuleiten und dass sie eindeutig messbar sind. Bei der Definition der strategischen Ziele ist eine direkte Verbindung zum Markt, den Produkten, dem Kundennutzen (Mehrwert) und der eigenen Wettbewerbsposition sowie der Unternehmensorganisation herzustellen. Das bedeutet, dass man nicht nur wissen sollte, was man erreichen will, sondern dass man auch beurteilen kann, wie das Unternehmen im Marktumfeld positioniert ist. Im Gegensatz zu nachgelagerten Zielen (oft Ober- und Unterziel genannt) fokussieren sich strategische Ziele selten auf einzelne Geschäftsbereiche, Produkte oder Märkte. Strategische Ziele sind gewöhnlich übergeordnete und das gesamte Unternehmen betreffende Ziele. Innerhalb der sogenannten Zielpyramide stehen sie daher auch an der Spitze. Je nach Größe und Komplexität des Unternehmens sind die strategischen Ziele im Nachgang durch Ziele in den einzelnen Märkten, Produkten oder Organisationseinheiten zu untersetzen (Geschäftsfeldstrategie, Produktstrategie etc.).
Das wohl geläufigste Instrument bei der Ableitung strategischer Ziele ist die SWOT-Analyse:
Strategische Ziele haben folgende Merkmale:
Strategische Ziele werden häufig in Kategorien definiert:
Die Anzahl der gültigen strategischen Ziele ist auf ein sinnvolles und nützliches Maß zu begrenzen, da im weiteren Verlauf der Strategie eine inhaltliche Untersetzung und Aufgliederung erfolgt. Ist dabei die Zahl der strategischen Ziele bereits hoch bzw. zu hoch, besteht hinsichtlich der Gesamtplanung akute „Explosionsgefahr“. Ein vielerorts praxisbewährter Ansatz für sinnvolles Management von Vorgängen mit höchster Priorität ist, im einstelligen Bereich zu bleiben, also <10>
3. KERNMASSNAHMEN
Unter Kernmaßnahmen sind eher übergreifende, robuste Maßnahmenbündel zu verstehen, welche zur Erreichung der strategischen Ziele zwingend notwendig sind. Ganz im Sinne der SWOT-Analyse, sind darunter sowohl die Maßnahmen zur Ergreifung von Chancen und Möglichkeiten als auch zur Vermeidung von Bedrohungen oder zur Reduzierung von Risiken zu verstehen. Wichtig ist es, an dieser Stelle sehr bewusst auch Kernmaßnahmen zu definieren, welche die notwendige Weiterentwicklung der Unternehmensorganisation oder -kultur abbilden. Es ist ein häufiger Mangel in der Unternehmenspraxis, dass organisatorische, strukturelle oder kulturelle Maßnahmen im Rahmen der Strategie nicht auf die gleiche Art und Weise geplant und behandelt werden, wie die geschäfts- oder produktbezogenen Maßnahmen.
Die Kunst bei der Ableitung guter Kernmaßnahmen besteht darin, dass:
Eine gängige Variante zur Visualisierung, Planung und Nachverfolgung von Kernmaßnahmen ist die Verwendung einer sogenannten strategischen Roadmap mit Verantwortlichkeiten.
4. RESSOURCEN
Strategische Planungen, welche über eine Vision, strategische Ziele und Kernmaßnahmen verfügen ermöglichen eine dedizierte Ressourcenabschätzung mit Blick auf die erfolgreiche Strategieumsetzung. Hier, auf der Ebene der strategischen Planung, geht es dabei noch nicht um korrekte Detailpläne oder Einzelbedarfe. An dieser Stelle geht es zunächst darum, eine GAP-Analyse zu ermöglichen und grobe Bedarfszahlen abzuleiten. Das ist an dieser Stelle nicht nur für die spätere operative Planung wichtig, sondern auch für die Bewertung von strategischen Machbarkeiten oder Hindernissen. Darüber hinaus unterstützt diese grobe Ressourcenbedarfsschätzung auch die notwendige Fokussierung auf die wesentlichsten Dinge, welche mit begrenzten Ressourcen zu realisieren sind.
Ein strategischer Ressourcenbedarf ist also nicht mit einem Stellenbedarfsplan oder mit einzelnen Investitionsbudgets gleichzusetzen. Diese leiten sich aus den nachgelagerten Planungen ab.
5. PERFORMANCE
Viel zitiert, oft gewollt und dennoch häufig unzureichend abgebildet ist das Thema Performance im Rahmen der Strategie. Oftmals werden die Performancekennzahlen (KPI) nur unmittelbar aus den Formulierungen der strategischen Ziele abgeleitet. Das ist zwar gut, um die Erreichungsgrade oder GAP´s der strategischen Ziele abzuleiten. Es genügt aber nicht immer, um die Erreichung, den Fortschritt und eventuelle Korrekturbedarfe hinsichtlich der Kernmaßnahmen zu erkennen und abzuleiten.
Kennzahlen (KPI) zur Messung und Bewertung der strategischen Performance sollten:
6. PLÄNE
Das Abbild der Unternehmensstrategie ist der Plan, wobei es nicht ein einziges Dokument oder eine einzige Quelle ist, sondern in der Regel aus mehreren Teilen besteht. Dazu zählen der Ergebnisplan (P&L), der Maßnahmenplan (Roadmap), der Investitionsrahmen und der Personalrahmen. Ähnlich wie bei der Roadmap, liegt im Rahmen der strategischen Planung der Fokus auf den Gesamtzahlen und Rahmenbudgets. Sämtliche nachgelagerten Detailpläne folgen im Rahmen der operativen Planung (Teilziele, Aktionspläne/Sprints o.ä., Liquiditätsplan, Personalentwicklungsplan etc.), die in der Regel nach der Strategiefestlegung erfolgt bzw. periodisch aktualisiert wird.
Die Kunst des strategischen Managements besteht darin, Denkweisen der strategischen und operativen Planung zielgerichtet miteinander zu verbinden und die Strategie dadurch strukturell und verbindlich zu operationalisieren, also umsetzbar zu machen. Das klingt banal ist in der Praxis aber ein häufiges Defizit. Nicht selten wird zwischen dem Erstellen visualisierter Strategien und dem konkreten operativen Handeln keine oder eine nur unzulängliche Verknüpfung hergestellt. In diesen Fällen können Strategie- oder Jahresrückblicke schnell zu Entdeckungsreisen werden, in denen aktiv gesteuerte Zusammenhänge seltene Erscheinungen sind.